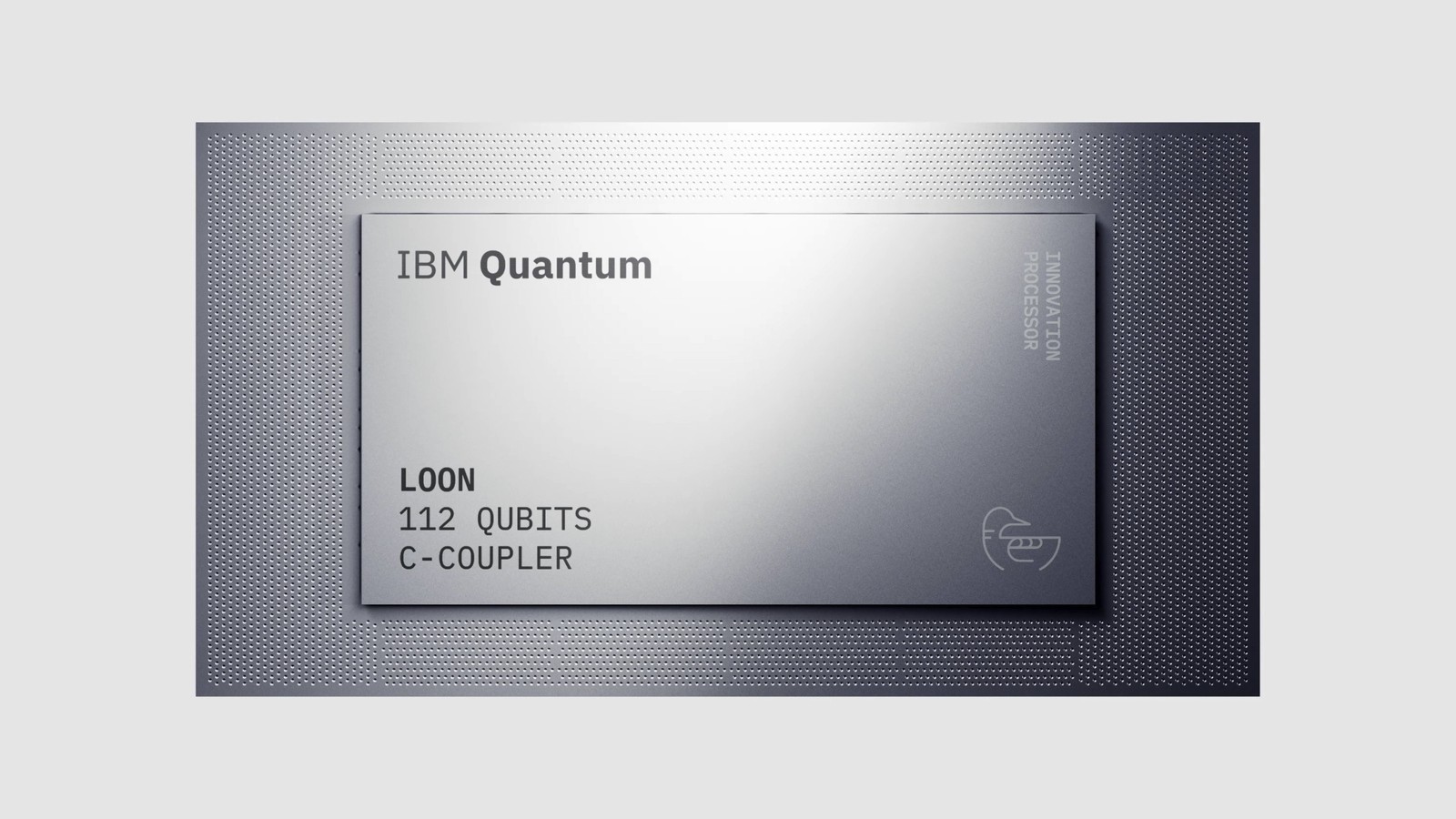IBM hat zwei neue Quantenverarbeitungseinheiten (QPUs) vorgestellt, die den Weg zum praktischen Quantencomputing beschleunigen sollen. Zu diesen Entwicklungen gehören der 120-Qubit-Prozessor Nighthawk, der eine Leistungssteigerung von 30 % gegenüber früheren Modellen bietet, und der 112-Qubit-Prozessor Loon, der als Blaupause für vollständig fehlertolerante Quantenberechnungen entwickelt wurde.
Skalierung der Leistung mit Nighthawk
Der Nighthawk -Prozessor verbessert die Qubit-Konnektivität durch verbesserte abstimmbare Koppler, sodass jedes seiner 120 Qubits mit vier Nachbarn verbunden werden kann. Diese Architektur unterstützt Quantenberechnungen, die bis zu 5.000 Zwei-Qubit-Gates erfordern – grundlegende Operationen im Quantencomputing. IBM will Nighthawk bis 2026 bzw. 2027 auf 7.500 bzw. 10.000 Gates ausbauen, mit einem langfristigen Ziel von 15.000 Gates auf einem 1.000-Qubit-System bis 2028.
Das Streben nach Fehlertoleranz mit Loon
Während die Anzahl der Qubits wichtig ist, besteht die eigentliche Herausforderung darin, Fehler zu minimieren. Der Loon -Prozessor konzentriert sich darauf, indem er alle Hardwarekomponenten integriert, die für fehlertolerantes Quantencomputing notwendig sind. Das bedeutet, dass der Prozessor darauf ausgelegt ist, Fehler in Echtzeit selbst zu erkennen und zu korrigieren – ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer zuverlässigen Quantenberechnung.
Warum Fehlerkorrektur wichtig ist
Quantencomputer sind von Natur aus instabil und Qubits sind fehleranfällig. Der Loon -Prozessor behebt dieses Problem durch die Integration von Quantenfehlerkorrekturtechnologien (QEC). Bei QEC geht es nicht darum, größere Prozessoren herzustellen; es geht darum, zuverlässigere Prozessoren zu machen. Der 1.000-Qubit-Chip Condor von IBM war zwar groß, aber aufgrund der geringeren Fehlerrate weniger vielversprechend als sein 127-Qubit-Gegenstück Eagle.
Neue Technologien in den Prozessoren
Oliver Dial, CTO von IBM, hob mehrere neue Funktionen der Prozessoren hervor: Sechs-Wege-Qubit-Verbindungen (die es jedem Qubit ermöglichen, sich mit bis zu sechs Nachbarn zu verbinden), größere Routing-Schichten, längere Koppler und „Reset-Gadgets“, um Qubits in ihren Grundzustand zurückzusetzen. Diese Technologien werden erstmals gemeinsam auf dem 112-Qubit-Prozessor Loon getestet.
Modulares Design und der Kookaburra-Prozessor
IBM entwickelt außerdem den Kookaburra -Prozessor, der für 2026 erwartet wird. Dabei handelt es sich um die erste modular aufgebaute QPU, die logische Operationen mit Speicherspeicherung kombiniert. Der modulare Aufbau ermöglicht skalierbarere und zuverlässigere Quantensysteme.
Verfolgung des Quantenvorteils
IBM hat einen Quantenvorteil-Tracker entwickelt, um zu messen, wann Quantencomputer Probleme lösen können, die über die Fähigkeiten klassischer Supercomputer hinausgehen. Der Tracker umfasst drei anfängliche Herausforderungen: beobachtbare Schätzungen, Variationsprobleme und klassisch überprüfbare Probleme.
Fortschritte in der Wafer-Herstellung
IBM stellt außerdem auf die Herstellung von 300-mm-Wafern (12 Zoll) um. Dieses neue Format halbiert die Prozessorbauzeit und erhöht die Chipkomplexität um den Faktor zehn. Der Prozess umfasst das Schneiden von Siliziumzylindern in dünne Scheiben, das Entwerfen von Schaltkreisen mit Software, das Ätzen von Schaltkreisen, das Abscheiden von Metallen, die Behandlung von Wafern und das Schichten/Verbinden von Chips.
Fazit: Die neuesten Quantenprozessoren von IBM, Nighthawk und Loon, stellen bedeutende Schritte in Richtung praktisches Quantencomputing dar. Der Fokus auf Leistungsskalierung und Fehlerkorrektur in Kombination mit Fortschritten bei der Waferherstellung positioniert IBM als Spitzenreiter im Wettlauf um Quantenvorteile und den Bau fehlertoleranter Quantencomputer bis 2029