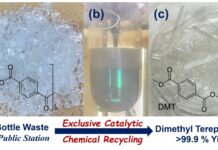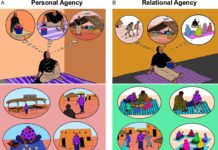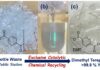Die britische Regierung stellt sich eine Zukunft vor, in der Tierversuche selten und nur in Ausnahmefällen durchgeführt werden. Obwohl Fortschritte erzielt wurden – die Zahl ist von einem Höchststand von 4,14 Millionen im Jahr 2015 auf 2,88 Millionen im Jahr 2020 gesunken –, ist dieser Rückgang nun ins Stocken geraten. Die Frage ist nicht mehr, ob Tiere ersetzt werden können, sondern wann und wie.
Der Plateau-Effekt
Der anfängliche Rückgang des Tierverbrauchs war auf die Einführung alternativer Methoden zurückzuführen, darunter In-vitro -Studien (zellbasierte Studien), Computermodelle und fortschrittliche Bildgebungstechniken. Diese Methoden bieten Geschwindigkeit, Kosteneffizienz und häufig eine höhere Genauigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Tiermodellen. Bestimmte Bereiche – insbesondere komplexe biologische Systeme und Langzeittoxizitätsstudien – sind jedoch immer noch stark auf Tiere angewiesen.
Dr. Chris Powell, Direktor von Cambridge BioPharma Consultants Ltd., weist darauf hin, dass sich die verbleibende Verwendung von Tieren auf Bereiche konzentriert, in denen Alternativen noch nicht vollständig validiert oder von den Aufsichtsbehörden akzeptiert wurden. Dies gilt insbesondere für die Arzneimittelentwicklung, bei der Sicherheit und Wirksamkeit vor Versuchen am Menschen rigoros nachgewiesen werden müssen.
Die Rolle neuer Methoden
Das National Center for the Replacement, Refinement, and Reduction of Animals in Research (NC3Rs) steht an vorderster Front bei der Entwicklung und Förderung dieser Alternativen. Dr. Natalie Burden, Leiterin von New Approach Methodologies bei NC3Rs, betont die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Regulierungsbehörden und der Industrie, um die Einführung tierversuchsfreier Methoden zu beschleunigen.
Ein vielversprechender Bereich ist die Organ-on-a-Chip -Technologie, die die Funktion menschlicher Organe in einem mikrofluidischen Gerät nachbildet. Diese Chips können komplexe physiologische Reaktionen nachahmen und relevantere Daten liefern als herkömmliche Zellkulturen. Ein weiterer Ansatz ist die Computertoxikologie, die KI und maschinelles Lernen nutzt, um die Toxizität von Arzneimitteln auf der Grundlage der Molekülstruktur vorherzusagen.
Regulatorische Hürden
Trotz der Fortschritte bleibt die regulatorische Akzeptanz ein großer Engpass. Behörden wie die FDA und die EMA benötigen für die Arzneimittelzulassung immer noch umfangreiche Tierdaten, auch wenn alternative Methoden verfügbar sind. Dies ist teilweise auf historische Präzedenzfälle und einen konservativen Ansatz bei der Risikobewertung zurückzuführen.
Jenseits des Labors: Gletscherverlust und Klimadaten
In einem separaten Beitrag präsentierte der Glaziologe Dr. Matthias Huss alarmierende Daten zum Schweizer Gletscherschwund. Im letzten Jahrzehnt ist ein Viertel des Schweizer Eises verschwunden und Hunderte von Gletschern sind vollständig verschwunden. Seine Forschung verdeutlicht die dringende Notwendigkeit von Klimaschutzmaßnahmen, da selbst konservierte Eisproben gefährdet sind.
Der Weg nach vorne
Um Tierversuche vollständig zu ersetzen, ist ein mehrgleisiger Ansatz erforderlich:
- Verstärkte Investitionen in alternative Technologien: Die Finanzierung sollte auf Organ-on-a-Chip, Computertoxikologie und fortschrittliche Bildgebung ausgerichtet sein.
- Regulierungsreform: Behörden müssen der Akzeptanz validierter tierversuchsfreier Methoden Priorität einräumen.
- Zusammenarbeit mit der Industrie: Pharma- und Chemieunternehmen müssen Alternativen nutzen, um die Abhängigkeit von Tiermodellen zu verringern.
Der stagnierende Rückgang der Tierversuche unterstreicht die bevorstehenden Herausforderungen. Während die Technologie einen brauchbaren Ersatz bietet, sind systemische Veränderungen erforderlich, um die Trägheit der Regulierung zu überwinden und sicherzustellen, dass die Zukunft der Wissenschaft sowohl ethisch als auch effizient ist